star.admin.ch – eine Plattform des Bundes zum Thema Antibiotikaresistenzen
Antibiotikaresistenzen sind ein weltweites Problem und betreffen den Menschen, das Tier, die Landwirtschaft und die Umwelt.
Im Fokus
One Health, eine Gesundheit

StAR im Humanbereich
Damit Patientinnen und Patienten, Ärzteschaft und Apothekerschaft ihre Verantwortung im Umgang mit Antibiotika wahrnehmen können, stehen verschiedene Richtlinien und Hilfsmittel zur Verfügung.

StAR im Veterinärbereich
In enger Zusammenarbeit fördert die Tierärzteschaft mit Kleintier- und Nutztierhaltenden den sachgerechten Antibiotikaeinsatz und präventive Massnahmen.

StAR im Bereich Landwirtschaft
Gesunde Tiere sind stark und brauchen keine Arzneimittel, so entstehen keine Antibiotikaresistenzen. Landwirtinnen und Landwirte und Tierärzteschaft sind deshalb gefordert die Tiergesundheit durch Prävention zu fördern.

StAR im Bereich Umwelt
Mit dem Ausbau von Abwasserreinigungsanlagen werden Verunreinigungen der Gewässer mit Antibiotika und anderen Mikroverunreinigungen gesenkt.
Wichtige Grundlageninformationen

Über StAR
Durch die Umsetzung der Strategie konnten seit 2016 zahlreiche Massnahmen auf- und ausgebaut werden. Mit dem One Health-Aktionsplan StAR 2024 – 2027 werden Aktivitäten intensiviert.

Antibiotikaeinsatz und Antibiotikaresistenzen in der Schweiz
Die Überwachung von Antibiotikaeinsatz und Resistenzen beim Menschen, bei Nutz- und Heimtieren sowie in der Umwelt ist ein wichtiger Teil der Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR).
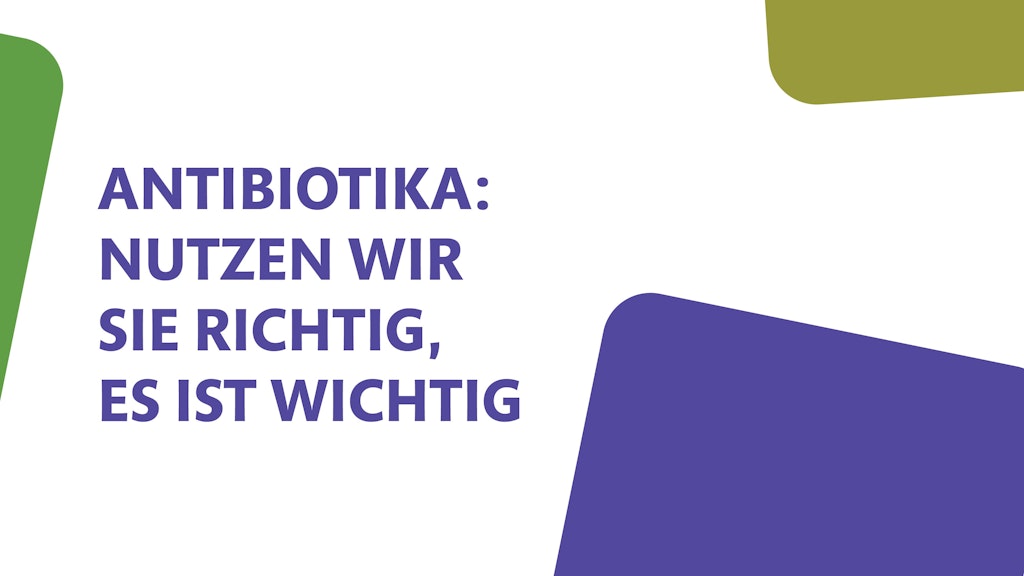
Antibiotika: Nutzen wir sie richtig, es ist wichtig
Damit wir weiterhin wirksame Antibiotika haben, müssen wir sie verantwortungsbewusst einsetzen. Wer Antibiotika verschrieben bekommt, muss auf die korrekte Einnahme und Rückgabe achten. Nutzen wir sie richtig, es ist wichtig.


